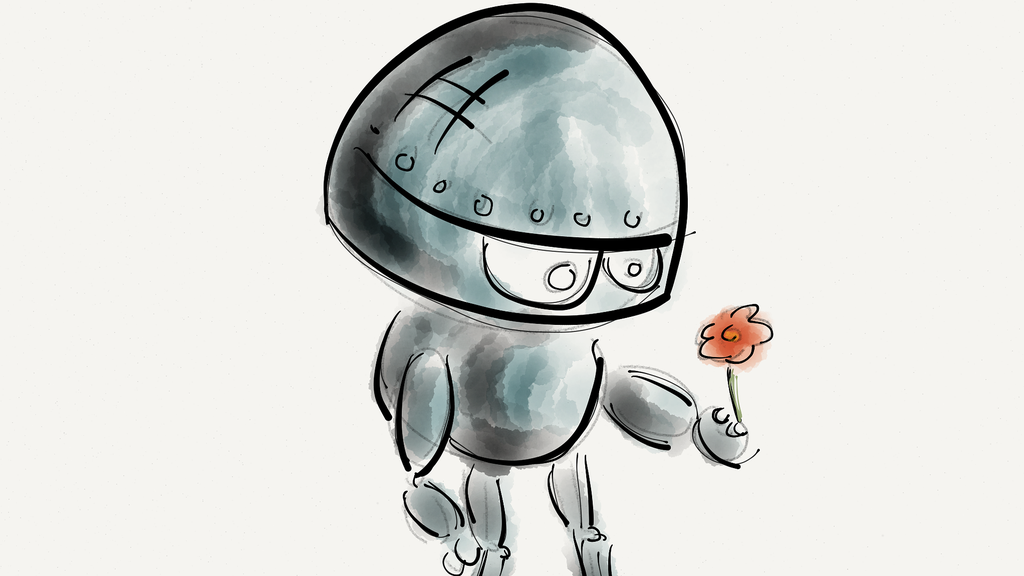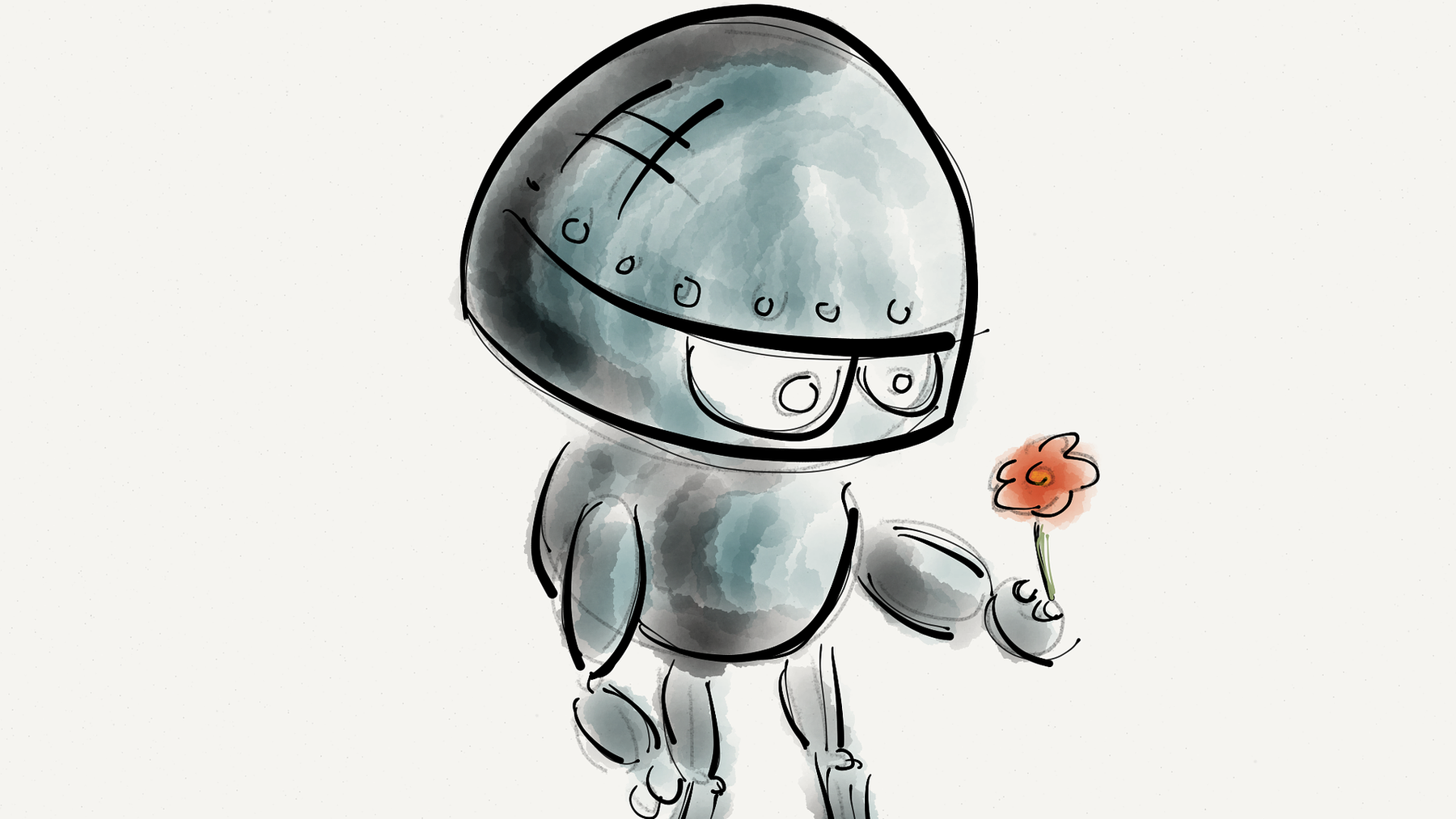Roboter werden emotional – und neugierig wie Babys
Seit ein paar Jahren erlebt die künstliche Intelligenz einen regelrechten Höhenflug. Computerprogramme übersetzen simultan mehrere Sprachen, lenken Autos selbstständig durch den Verkehr oder erklären blinden Menschen, was sich auf Fotos befindet. Ihr Erwachen verdankt die künstliche Intelligenz einerseits der sich rasant entwickelnden Rechenleistung der Computer. Andererseits wächst auch das Repertoire von typisch menschlichen Eigenschaften, das den Maschinen zur Verfügung steht, um ihre Aufgaben effizienter zu lösen. Eine dieser Fähigkeiten könnte der künstlichen Intelligenz schon im nächsten Jahrzehnt ermöglichen, den Menschen hinter sich zu lassen: Neugier.
«Mit neugierigen Maschinen knacken wir ein Grundsatzproblem der Computerwissenschaft», sagt Jürgen Schmidhuber vom Schweizer Institut für künstliche Intelligenz IDSIA, das zur Uni Lugano und zur Tessiner Fachhochschule SUPSI gehört. Denn obschon die Computer viele Aufgaben mittlerweile mit Bravour – oft sogar besser als Menschen – bewältigen, lernen die meisten Maschinen nur gerade das, wozu sie Menschen zwingen. Nicht so in Schmidhubers Labor. «Ich glaube zu verstehen, wie Neugier funktioniert», sagt er. Sie beruhe auf Prinzipien, die auch eine Maschine in sich tragen könne. «Um einen Computer neugierig zu machen, reichen wenige Zeilen Programmiercode», sagt der Informatiker, dessen Entwicklungen zu künstlicher Intelligenz heute von Firmen wie Google, IBM und Microsoft eingesetzt werden. Schon seit Jahren experimentiert er am Institut und in der von ihm mitgegründeten Firma Nnaisense mit neugierigen Computerprogrammen, die in kleinem Rahmen selbstständig neue Dinge ausprobieren können. «Die Maschinen freuen sich, wenn sie eine neue Entdeckung machen. Und langweilen sich an dem, was sie schon gut kennen», sagt der Informatiker.
«Computer und Menschen werden wohl durch ähnliche Mechanismen angetrieben, Neues zu entdecken», sagt Schmidhuber. Versucht ein Kind beispielsweise, einen Ball in einen Korb zu werfen, lernt es dabei eine Menge über die Flugbahn von Objekten, die Anziehungskraft der Erde und die Aerodynamik von Materialien. Auch wenn das unbewusst geschieht – das Kind verinnerlicht dabei Regeln. Bald wird es deshalb auch andere, ihm neue Gegenstände fast so zielgenau werfen können wie den Ball. Und jedes Mal, wenn es eine solche Fähigkeit neu erwirbt, empfindet es ein Erfolgserlebnis. «Nach diesem Gefühl streben wir ein Leben lang», sagt Schmidhuber. «Es treibt uns an, Fähigkeiten zu erlernen, Experimente zu machen und die Welt besser zu verstehen.»
Wissbegierig wie ein Baby
Dieser Trieb kann Computern eingepflanzt werden, damit auch sie ihre Neugier befriedigen und selbstständig neue Dinge lernen wollen. Und zwar mit einem Anreizsystem, das die Maschine für jeden Erkenntnisgewinn belohnt. Möglich wird das, weil sich die Erkenntnisse eines Computers direkt messen lassen – etwa in Form des Speicherplatzes, den er für eine Aufgabe benötigt. Soll ein Computer beispielsweise anhand von Videos herunterfallender Äpfel voraussagen, wann die Früchte am Boden aufschlagen, muss er zu Beginn jeden Sekundenbruchteil des Films mitverfolgen und in seine Berechnung mit einbeziehen. Für diese Daten braucht er viel Speicherplatz. Sobald er die Regeln der Schwerkraft entdeckt hat, reicht ihm ein einziges Standbild aus, um eine präzise Vorhersage zu treffen. Den Rest des Videos braucht er dazu nicht mehr abzuspeichern. Für diese Ersparnis an Speicherplatz wird der Computer belohnt. Das Erfolgserlebnis treibt ihn an, weitere Entdeckungen durch Experimente zu machen – er zeigt Neugier wie ein Baby.
Computer und Menschen scheinen also zumindest teilweise denselben simplen Regeln zu folgen. Das bestätigen auch Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung. «Wir sind zwar noch weit davon entfernt, den Menschen komplett zu verstehen», sagt der Neurowissenschafter und Psychiater Dominik Bach vom Universitätsspital Zürich. «Doch in vielen Bereichen lässt sich unser Verhalten mit mathematischen Modellen beschreiben.» Am Zentrum für Neurowissenschaft erstellt er solche Modelle für verschiedene menschliche Verhaltensweisen, beispielsweise für den Reflex des Erschreckens. So hat Bach einfache Regeln entdeckt, nach denen unser Gehirn entscheidet, wie stark uns etwas erschreckt: Es berechnet die Stärke direkt aus der potenziellen Gefahr, die wir in der jeweiligen Situation wahrnehmen. Befinden wir uns etwa im Wald, erschrecken wir uns stärker als zu Hause, weil hinter den Bäumen Feinde lauern könnten.
Uns bald ebenbürtig?
Auch viele andere Gefühle kann man mathematisch beschreiben. Doch wenn der Mensch ähnlich wie ein Computer durch Regeln gesteuert wird – was ist denn noch besonders am Menschen? Und werden uns die Computer bald auch in emotionalen Bereichen ebenbürtig? «Ich glaube, dass es einen Unterschied gibt», sagt Bach. Denn auch wenn Computer auf dieselbe Weise neugierig, kreativ und motiviert sein können wie Menschen, fehlt ihnen die subjektive Wahrnehmung. «Ihnen fehlt das Erleben, das Fühlen», sagt Bach. «Sie können zwar zum Beispiel motiviert sein, sich aber nicht motiviert fühlen.» Ob sich das mit der zunehmenden Komplexität der künstlichen Intelligenz in Zukunft ändern wird, vermag heute kein Mensch zu sagen. Vielleicht wird es einst eine fortgeschrittene künstliche Intelligenz geben, die das menschliche Gehirn entschlüsselt und uns hilft, uns selbst zu verstehen.
Von Michael Baumann