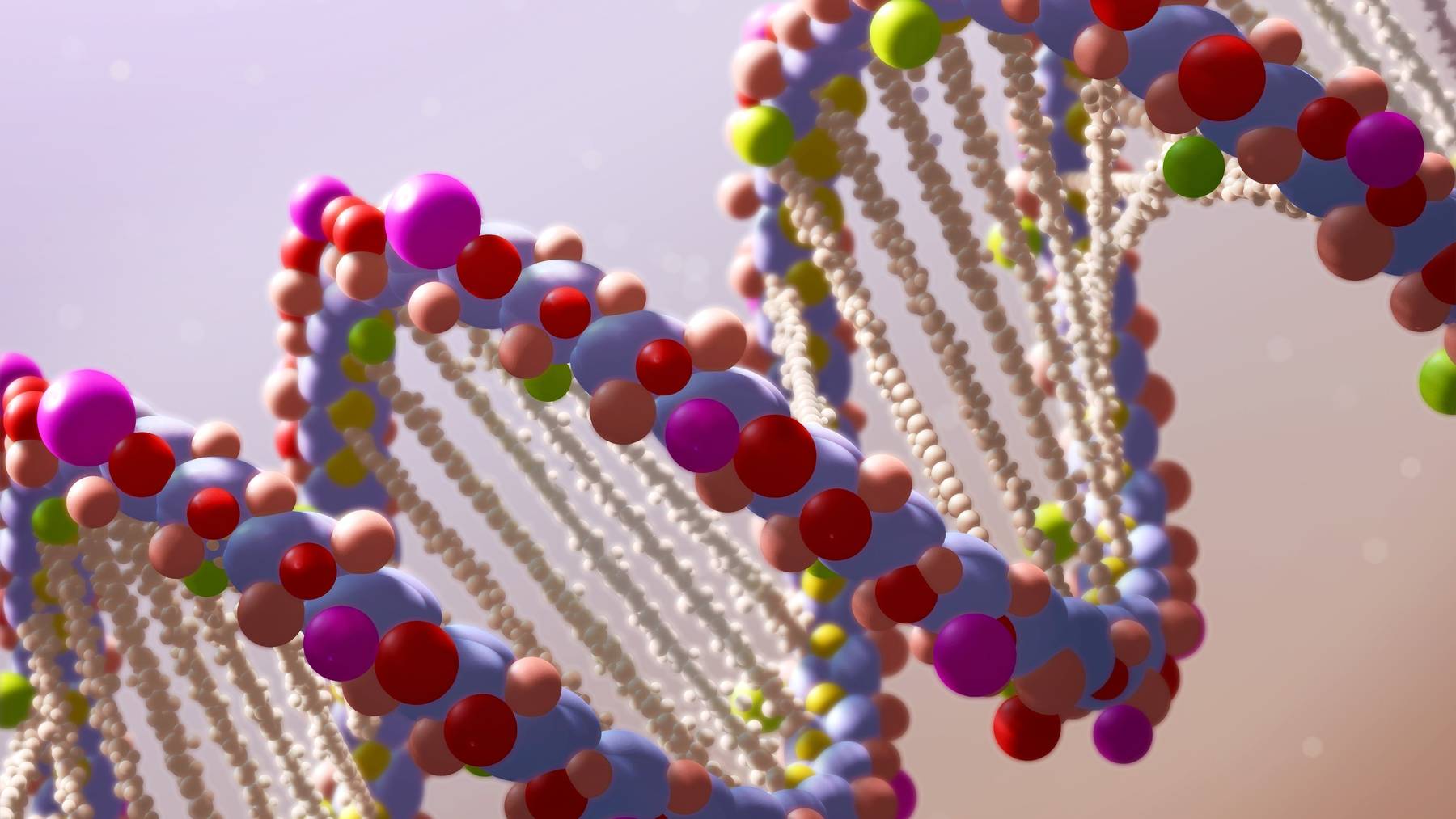Strippen für die Forscher: Warum Tausende Menschen ihre Gen-Daten im Netz veröffentlichen
Schon einmal ins Familienalbum geguckt und sich gefragt, warum Mama und Papa schwarzhaarig, die Kinder aber alle blond sind? Oder weshalb Cousin Luca blaue Augen hat, wo Tante Pia und Onkel Theo doch beide braune haben? Doch wen fragt man da, will man eine Antwort haben?
Mama und Papa haben meist keine Ahnung, und Opa fragt man besser nicht, will man nicht alle Familiengeschichten bis anno 1500 erzählt bekommen. Bleibt die Alternative: DNA-Analyse. Man bestellt sie heute einfach über Onlineportale wie 23andMe oder MyHeritage. Dort registriert man sich, bekommt ein DNA-Kit geschickt und spuckt dann fleissig in ein Plastikröhrchen. Das wird zurückgeschickt und von einem Labor ausgewertet.
Solche Tests werden mittlerweile rund um den Globus verschickt. Allein die Datenbank von 23andMe umfasst heute über eine Million Nutzer. Während ein Grossteil die Analyse zum Privatvergnügen und vor allem macht, um mehr über sich und seine Ahnen zu erfahren, gehen einige einen Schritt weiter: Sie teilen ihre Gen-Daten mit der breiten Öffentlichkeit.
Tausende solcher Datensätze tummeln sich schon auf Open-Source-Plattformen wie OpenSNP oder Open Humans. Sie stammen von Privatpersonen, die ihre DNA-Analyse samt Resultaten bereits erhalten und sie selbstständig und unentgeltlich ins Netz gestellt haben. Dort können die Daten vom Laien bis zum Forscher eingesehen und heruntergeladen werden.
Doch weshalb gibt es Personen, die ihre ganz individuelle Essenz veröffentlichen? Und das in Zeiten, in denen das Thema Privatsphäre im Internet brandaktuell ist? Diese Frage hat sich Effy Vayena von der Universität Zürich gestellt und gemeinsam mit dem Soziologen Tobias Häusermann eine aktuelle Studie durchgeführt. 550 zufällig ausgewählte Teilnehmer wurden nach ihren Motiven befragt.
«Wir haben festgestellt, dass diese Leute kleine Aktivisten sind. Sie verfolgen mit der Veröffentlichung ein Ziel, nämlich sich selbst an der Wissenschaft zu beteiligen und sie vorwärtszutreiben», erläutert die Wissenschafterin. Dabei sollen nicht nur medizinische, sondern auch soziale Fragestellungen anhand der Daten eine Antwort finden.
Rohdaten für Spezialisten
Dass die «Citizen Scientists» ihre Daten derweil nicht nur der Wissenschaft, sondern allen, und damit auch Versicherungen und anderen Unternehmungen, zur Verfügung stellen, das wird dabei offenbar bewusst in Kauf genommen. Der Soziologe Tobias Häusermann sagt dazu: «Die Probanden schätzen das Risiko, dass ihre Daten zu ihrem Nachteil verwendet werden, als gering ein.» Gleichzeitig zeigen sich dieselben Probanden dennoch besorgt über die Möglichkeit, dass ihre Daten missbraucht werden könnten.
Klingt paradox, ist es aber nicht, meint Effy Vayena: «Das muss kein Widerspruch sein. Unsere Studie zeigt ja, dass die Probanden nicht apathisch über das Thema Privatsphäre hinweggehen, sondern sogar besonders darauf sensibilisiert sind. Sie gewichten die Risiken, und das wissenschaftliche Interesse überwiegt.»
Häusermann relativiert derweil: «Bei genetischen Daten handelt es sich auch um etwas, das wir immer bei uns tragen und gleichzeitig schnell verlieren können. Ein Haar ist mit einer Bewegung weggewischt oder ausgezupft und kann einfach analysiert werden. Sicher ist man also nie. Von der Offenheit derjenigen, die ihre Daten zur Verfügung stellen, kann sich auch überzeugen, wer einmal auf Plattformen wie OpenSNP surft.
Über 600 Personen geben dort etwa darüber Auskunft, ob sie ihre Zunge rollen können. Rund 5000 Personen haben ihre vollständigen DNA-Analysedaten hochgeladen. Barrierefrei kann darin gestöbert werden. Eine Meldung, dass der Zugriff verweigert wird, erscheint nicht. Doch ganz so demokratisch, wie die Datenbank anmutet, ist sie nicht. Will man stichhaltige Erkenntnisse aus den Daten, insbesondere den einzelnen Genom-Daten gewinnen, braucht es laut Tobias Häusermann mehr: «Viele Daten liegen als Rohdaten vor. Will man sie wissenschaftlich analysieren, benötigt man ein Algorithmus, der gezielt findet, was man sucht.»
Laien können das nicht. Experten sind gefragt. Das schränkt den tatsächlichen Nutzerkreis ein. «Natürlich können vor allem Experten die Daten bearbeiten und nutzen. Neu ist aber, dass die Möglichkeit besteht, dass alle diese Daten zu Gesicht bekommen», fügt Häusermann an.
Anzeichen dafür, dass die Probanden womöglich Wegbereiter eines Trends sind, sehen die Studienleiter denn auch in der Zusammensetzung ihrer Studienteilnehmer. Die ist vor allem punkto Bildungsstand überraschend ausgewogen. «Eigentlich hätten wir erwartet, dass die Teilnehmer im Schnitt höhere Bildungsabschlüsse vorweisen», bemerkt Effy Vayena zur Tatsache, dass die Probanden nicht nur alters-, sondern auch bildungsmässig ausgewogen vertreten sind. Denn diese hätten sicher ein grösseres Interesse, die Wissenschaft mit ihren Daten zu unterstützen.
Genetische Daten nicht nur zum Privatvergnügen zu erheben, sondern als Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft zu verstehen: Diesen Idealismus teilen Nicht-Akademiker also ebenso wie Akademiker.
Von Julia Monn